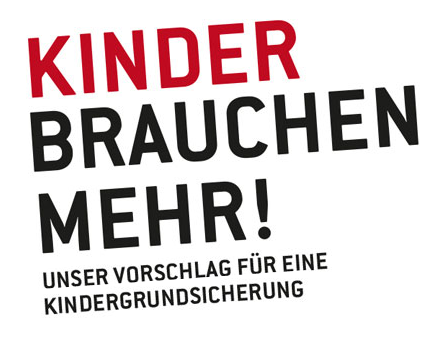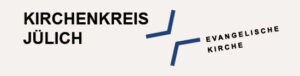Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG setzt sich seit 2009 für eine grundlegende Reform der Kinder- und Familienförderung hin zu einer Kindergrundsicherung ein. Dem Bündnis gehören aktuell 20 Mitgliedsorganisationen und 12 wissenschaftliche Unterstützer*innen an. Um soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen und jedem Kind, unabhängig von seiner sozialen Herkunft Teilhabe zu ermöglichen, schlagen wir folgendes Konzept für eine echte KINDERGRUNDSICHERUNG vor:
Unser Konzept
Presse
Materialien
Hier finden Sie alle aktuellen Materialien des Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG.
Unterstützende Verbände

Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e.V.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. (DPWV)

Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Unterstützung durch die Wissenschaftler*innen
Prof. Jutta Allmendinger, PhD, Wissenschaftszentrum Berlin
Prof. Dr. Hans Bertram, HumboldtUniversität zu Berlin
Prof. Ullrich Gintzel, Evangelische Fachhochschule Dresden
Prof. Dr. Walter Hanesch, Hochschule Darmstadt
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Hertie School of Governance Berlin
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, Evangelische Fachhochschule RWL
Prof. Dr. Heiner Keupp, LudwigMaximilian Universität München Prof. Dr. Ronald Lutz, Fachhochschule Erfurt
Christiane Meiner-Teubner, M.A., Forschungsverbund DJI/TU Dortmund
Dr. Gisela Notz, Freiberufliche Wissenschaftlerin, Berlin
Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Schimke, Bürgermeister a.D.
Prof. Dr. Margherita Zander, Fachhochschule Münster
Anschrift
Der Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Kalckreuthstraße 4
10777 Berlin
Kontakt
Tel. 030-214 809 0
Fax 030-214 809 99
www.dksb.de
info (at) dksb.de